Die Lüge, dass 1% der Welt asexuell sei
Oder: Niemand zitiert Bogaert richtig! Eine Tirade mit Fußnoten
»Schätzungen zufolge sind ca. 1% der Menschheit a_sexuell« (Queer Lexikon, o.S.), liest man häufig – zumindest, wenn man sich wie wir intensiver mit Asexualität befasst. Manchmal wird etwas konkreter auf den Ursprung dieser Behauptung verwiesen: »Eine britische Studie geht von etwa einem Prozent der Bevölkerung aus.« (AktivistA, o.S.) Aber stimmt das?
Wie der Titel dieses Essays bereits verdeutlicht, lautet die Antwort darauf: Nein. Ganz so einfach ist es dann aber leider trotzdem nicht. Schauen wir uns an, warum.
Die Ergebnisse besagter Studie wurden von Anthony F. Bogaert unter dem Titel »Asexuality: Its Prevalence and Associated Factors in a National Probability Sample« (dt. sinngem.: »Asexualität: Verbreitung und angrenzende Faktoren in einer nationalen Wahrscheinlichkeitsstichprobe«) in The Journal of Sex Research veröffentlicht (vgl. Bogaert, 2004). Das Journal ist eine wissenschaftliche Fachzeitschrift im Bereich der Sexualwissenschaft und wird vom renommierten wissenschaftlichen Verlagshaus Routledge herausgegeben. So weit, so wissenschaftlich fundiert, also wo ist dann das Problem?
Das Problem liegt unter anderem in dem, was mit dieser Veröffentlichung gemacht wurde und wird. So wird in Aussagen wie den oben genannten etwa so viel Kontext ignoriert, dass sie stellenweise fundamental falsch werden. Um herauszufinden, was dazu beigetragen hat, schauen wir uns Bogaerts Studie etwas genauer an, die im Rahmen solcher Behauptungen fast immer als einzige Referenz genannt wird:
- In welchem Kontext ist die Studie entstanden?
- Wie wird sie im Forschungsstand ihrer Zeit verortet?
- Was für ein Verständnis von Asexualität verwendet Bogaert für seine Studie?
- Wie wurde und wird die Studie im Aktivismus und in der Wissenschaft rezipiert?
1. Bogaerts Studie
Professor Anthony Francis Bogaert ist Psychologe an der Brock University in St. Catherines, Ontario, Kanada. Er forscht unter anderem zu Asexualität (vgl. Brock University, o.S.) und ist vor allem in der ace Community sowie innerhalb der Asexuality Studies bekannt für seinen 2004 veröffentlichten Text »Asexuality: Prevalence and Associated Factors in a National Probability Sample«. Dort schreibt er: »Von den Teilnehmenden berichteten 195 oder 1,05%, asexuell zu sein.« (i.O.: »Of the participants, 195 or 1.05% reported being asexual.« Bogaert, 2004, S. 282.) So weit, so gut. Wer nur diesen Teil liest, denkt sich: Ja, aber da schreibt er doch genau das, was hier als Lüge bezeichnet wird: ca. 1% sind asexuell.
Was dabei fehlt, ist Kontext. An der zitierten Aussage, mit der Bogaert den Ergebnisteil seiner Studie einleitet, hängt in seiner Publikation eine Fußnote. Dort steht: »Obwohl sie nicht Asexualität per se diskutieren, so präsentieren Johnson et al. (1994, vgl. S. 187) eine Tabelle, welche die Verteilung sexueller Anziehung zeigt.« (i.O.: »Although they do not discuss asexuality per se, Johnson et al., (1994, see p. 187) do present a table showing the distribution of sexual attraction.« Bogaert, 2004, S. 282.)

Bildbeschreibung: Ausschnitt aus einem Text: »Results: Of the participants, 195 or 1.05% reported being asexual.[1] [1]Although they do not discuss asexuality per se, Johnson et al., (1994, see p. 187) do present a table showing the distribution of sexual attraction.«
Hieraus sowie aus dem Titel der Studie lassen sich einige Erkenntnisse gewinnen, anhand derer wir uns den Kontext nach und nach zusammenbauen können:
Bogaert bezieht sich auf eine Publikation von Johnson et al. aus dem Jahr 1994, in der sexuelle Anziehung untersucht wurde,
er bezieht sich auf eine Wahrscheinlichkeitsstichprobe (engl.: "National Probability Sample"), die an irgendeine Nation oder Nationalität angegliedert ist,
er spricht unterschiedliche Verständnisse von Asexualität an, indem er zwischen »Asexualität per se« und »Verteilung von sexueller Anziehung« unterscheidet (i.O.: »asexuality per se« und »distribution of sexual attraction«, beides Bogaert, 2004, S. 28)..
Diese Erkenntnisse wiederum werfen Fragen auf wie: Wer sind Johnson et al.? Was für eine Publikation ist das? Welche Nation ist gemeint? Inwiefern verstehen Bogaert und Johnson et al. unter dem Begriff Asexualität verschiedene Dinge?
2. Johnson et al. und Natsal
Ein Blick ins Literaturverzeichnis liefert gleich Antworten auf die ersten zwei Fragen. Bei der Publikation handelt es sich um den Band »Sexual attitudes & lifestyles« (Natsal, o.S.), der 1994 von A. Johnson, J. Wadsworth, K. Wellings und J. Field herausgegeben wurde. Hierbei handelt es sich um vier Forscherinnen:
die Epidemologin Dr. Anne Mandall Johnson, die einen Forschungsschwerpunkt in der AIDS-Forschung sowie in anderen sexuell übertragbaren Infektionen und infektiösen Krankheiten hat,
die Medizinstatistikerin Jane Wadsworth, die eine Pionierin in akademischer Forschung rund um sexuelle Gesundheit war3,
die Bildungsreferentin und Forscherin Kaye Wellings, die einen Forschungsschwerpunkt in sexueller und reproduktiver Gesundheit hat4 und
die Umfrageforscherin Julia Field (zu der es dreisterweise einfach keinen Wikipedia-Artikel oder sonstige Website gibt – zumindest keine, die wir gefunden haben).

Bildbeschreibung: Schwarz-weiß Foto von vier Personen, die an einer
Treppe stehen. Alle vier schauen in die Kamera. Neben jeder Person steht
ein Zitat und der Name der Person: vorne links: »When we started,
'condom' was only just becoming part of everyday language« – Julia Field;
vorne rechts: »There are very few books on sex that try to take an
objective view« – Anne Johnson; hinten links: »We were not concerned with
human motivation or pleasure.« – Jane Wadsworth; hinten rechts: »You
become so de-sensitised to all the giggle factors in the language« –
Kaye Wellings. Darunter die Bildunterschrift: »Figure 6: Julie Field, Jane Wadsworth, Kaye Wellings and Anne Johnson pictured in the Wellcome Building, Sunday Telegraph, 30 January 1994.
Diese vier Forscherinnen also haben 1994 das Buch »Sexual attitudes & lifestyles« herausgegeben. Dort veröffentlichen sie die Ergebnisse einer groß angelegten Umfragenreihe in Großbritannien, der so genannten »National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles« (dt. sinngem. »nationale Umfrage sexueller Einstellungen und Lebensstile«), kurz Natsal. Natsal gibt es mittlerweile in mehreren Ausführungen: die Umfragen für Natsal-1 wurden 1990–1991 durchgeführt, die Umfragen für Natsal-2 von 2000–2001, für Natsal-3 von 2010–2012, für Natsal-COVID von 2020–2021 und für Natsal-4 von 2022–2023. Alle Natsal-Versionen sind öffentlich zugänglich.
Natsal-1 ist somit die erste dieser Umfragen bzw. statistischen Erhebungen, die seit 1990 ca. alle 10 Jahre in Großbritannien durchgeführt werden. Laut Natsal-Website werden alle Umfragen mittels einer Wahrscheinlichkeitsstichprobe durchgeführt, »um zufällig Teilnehmer*innen aus ganz Großbritannien auszuwählen, was bedeutet, dass die Ergebnisse weitgehend repräsentativ für die generelle britische Bevölkerung sind.« (i.O.: »The surveys use a probability sampling method to randomly select people from across Britain to take part, which means that the results are broadly representative of the British general population.« Natsal-about, o.S.) Zudem betont die Natsal-Website, dass die Umfragen »von einer interviewenden Person persönlich und bei den Teilnehmenden zu Hause durchgeführt« (i.O.: »The surveys are administered by an interviewer face-to-face in the participant's home.« Natsal-about, o.S.) werden. Beides ist als Hintergrund v.a. für den nächsten Abschnitt dieses Textes relevant.
3. Großbritannien = (Nord-)Amerika = die Welt??
Kommen wir nochmal zurück zu der ›National Probablity Survey‹ und damit zu unserer dritten Frage vom Anfang. ›National‹ bezieht sich bei dieser Umfrage, wie bereits angemerkt, auf Großbritannien, d.h. auf die Länder England, Schottland und Wales1. Das bedeutet, dass es zwar eine groß angelegte Umfrage ist, aber dennoch eine örtlich gebundene. Wie kommen wir von da zu Aussagen wie der eingangs zitierten: »Schätzungen zufolge sind ca. 1% der Menschheit a_sexuell« (Queer Lexikon, o.S.)? Die ganze Menschheit lebt schließlich nicht in Großbritannien!
Auf dem Blog »Next Step: Cake« versucht ace Aktivist*in Sennkestra nachzuvollziehen, wie es dazu kommen konnte, dass in einer wissenschaftlichen Publikation folgende Behauptung stehen konnte: »Nach Anthony Bogaert beschreiben sich zwischen 1 und 6 Prozent der amerikanischen Bevölkerung als asexuell.« (i.O.: »According to Anthony Bogaert, between 1 and 6 percent of the American population describe themselves as asexual.« Sinwell, 2014, S. 328f. – hier in der Fußnote mit Verweis auf Bogaert, 2006.) Diese Behauptung stammt aus Sarah E. S. Sinwells Artikel »Aliens and Asexuality. Media Representation, Queerness, and Asexual Visibility« (dt. sinngem.: »Außerirdische und Asexualität. Mediale Repräsentation, Queerness und asexuelle Sichtbarkeit«), der 2014 in der von Routledge verlegten Anthologie »Asexualities: Feminist and Queer Perspectives« (dt. sinngem.: »Asexualitäten: Feministische und queere Perspektiven«) veröffentlicht wurde. Sennkestra schreibt zu Sinnwells Behauptung: »Natürlich war das einfach völlig falsch – es ist im besten Falle eine unfassbar verworrene Fehlinterpretation, oder im schlimmsten Falle eine bewusste Täuschung.« (i.O.: »Of course [...] it was just flat out wrong – it's an incredibly confused misinterpretation at best, or deliberate deception at worst.« Sennkestra, o.S.) Sennkestra kritisiert anhand von Sinwells Publikation unter anderem die Verschiebung in der Rezeption von einer britischen Umfrage zu Aussagen über die (US-)amerikanische Bevölkerung: »Aber diese Stichprobe kommt aus Großbritannien und hatte nichts mit Selbstidentität zu tun, anders als Sinwell behauptet.« (i.O.: »But this sample comes from Britain, and had nothing to do with self identity, unlike Sinwell's claim.« Sennkestra, o.S.) Zu letzterem Punkt mit der Selbstbezeichnung mehr im Abschnitt 5, Über welche Asexualität reden wir überhaupt?
Auch wenn es so scheinen mag, hat Sinwell sich diese Behauptung nicht einfach aus dem Ärmel gezogen, sondern belegt sie mit einem weiteren Artikel von Bogaert. Dieser wurde 2006 unter dem Titel »Toward a Conceptual Understanding of Asexuality« (dt. sinngem.: »Hin zu einem konzeptuellen Verständnis von Asexualität«) in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Review of General Psychology veröffentlicht, welche wiederum von der American Psychology Association (kurz: APA) herausgegeben wird. Dort schreibt Bogaert mit Verweis auf seine Studie von 2004: »Eine wichtige Erkenntnis aus meiner 2004er Studie betraf die Häufigkeit von Asexualität. Ungefähr 1% (n = 195) der Stichprobe gaben an, nie sexuelle Anziehung zu jemandem gehabt zu haben.« (i.O.: »One important finding from my 2004 study concerned the prevalence of asexuality. Approximately 1% (n = 195) of the sample reported never having had sexual attraction to anyone.« Bogaert, 2006, S. 242) Außerdem verweist er auf eine Umfrage des US-amerikanischen Fernsehsenders CNN: »[A]ls das Interesse der Boulevardpresse rund um das Thema Asexualität gegen Ende des Jahres 2004 seinen Höhepunkt erreichte, machte CNN eine Internetumfrage, in der sie Personen baten, ihre sexuelle Orientierung anzugeben. Ein ansehnlicher Anteil (6%) der nahezu 110.000 Teilnehmenden gab an, dass sie sich als asexuell identifizieren (›Studie‹, 2004)« (i.O.: »when the interest of the popular press surrounding the issue of asexuality reached its height in late 2004, CNN conducted an Internet poll asking people to self-identify their sexual orientation. A sizable proportion (6%) of the nearly 110,000 respondents reported that they identify as asexual (›Study,‹ 2004)« Bogaert, 2006, S. 247).

Bildbeschreibung: Umfrage von QuickVote zur Frage: »How would you categorize yourself?«, darunter vier Antwortoptionen: »Heterosexual«, »Homosexual«, »Bisexual« und »Asexual«. Darunter ein blau hinterlegter Link mit dem Text »View Results«, daneben ein blau hinterlegter Button mit dem Text »Vote«.

Bildbeschreibung: Ergebnisse der QuickVote-Umfrage: Heterosexual, 79%, 84713 votes Homosexual, 9%, 9487 votes Bisexual, 7%, 7469 votes Asexual, 6%, 6151 votes total: 107820 votes
Unter der Tabelle der Ergebnisse dieser CNN-Umfrage steht: »Diese QuickVote-Umfrage ist nicht wissenschaftlich und gibt nur die Meinungen derjenigen Internetnutzer*innen wider, die daran teilgenommen haben. Die Ergebnisse können weder als repräsentativ für die Meinungen von Internetnutzer*innen im Allgemeinen noch für die gesamte Öffentlichkeit angenommen werden. Der*die QuickVote-Sponsor*in ist nicht verantwortlich für Inhalte, Funktionalitäten oder dort veröffentlichte Meinungen.« (i.O.: »This QuickVote is not scientific and reflects the opinions of only those Internet users who have chosen to participate. The results cannot be assumed to represent the opinions of Internet users in general, nor the public as a whole. The QuickVote sponsor is not responsible for content, functionality or the opinions expressed therein.« QuickVote, o.S.) Anders als die Natsal-1-Umfrage, die von Johnson et al. explizit als repräsentativ für Großbritannien eingeschätzt wurde, wird hier explizit darauf verwiesen, dass die CNN-Umfrage nicht als repräsentativ für irgendetwas angesehen werden kann.
Außerdem wird im Vergleich mit Natsal-1 (deren Umfragen »von einer interviewenden Person persönlich und bei den Teilnehmenden zu Hause durchgeführt« (i.O.: »The surveys are administered by an interviewer face-to-face in the participant's home.« Natsal-about, o.S.) wuden) deutlich, dass ein Überblick darüber, wer an der Umfrage teilnimmt, viel schwieriger ist – um nicht zu sagen: unmöglich. Zwar hat mit CNN zwar ein US-amerikanischer Nachrichtensender diese Umfrage kreiert, aber grundsätzlich können all diejenigen Personen daran teilnehmen, die einen Internetzugang haben.
4. Der Umgang mit Asexualität in der Wissenschaft
Um noch einmal zu Sinwells Behauptung zurückzukommen, die der Auslöser für diesen CNN-Exkurs war: Nur anhand der CNN-Umfrage und Bogaerts Studie können wir nicht nachvollziehen, wie Sinwell zu der Aussage kam, dass 1–6% der Amerikaner*innen asexuell seien: CNN macht deutlich, dass ihre online Umfrage nicht repräsentativ für irgendetwas ist und Bogaerts Studie bezieht sich zwar auf eine Umfrage, die er als »eine der repräsentativsten Sexualitätsumfragen der letzten Jahre« (i.O.: »it is among the most representative sexuality surveys of recent years«. Bogaert, 2004, S. 281) bezeichnet, die aber explizit als repräsentativ für die britische Bevölkerung angenommen wird – nicht die amerikanische oder auch globale.
In einem Update zum Blogpost »The Anatomy of an Incorrect Citation« aus dem Jahr 2018 vermutet Sennkestra zu dieser Frage, Sinwells Behauptung auf einen Artikel der US-amerikanischen Women and Gender Studies-Professorin Breanne Fahs (Breanne Fahs, o.S.) zurückführen zu können. Dort behauptet Fahs: »Die meiste existierende Forschung zu Asexualität stellt zum Beispiel Fragen, die relativ wenig soziale und politische Relevanz haben. So sprechen etwa einige Studien Verbreitungsraten an, wobei meistens berichtet wird, dass sich zwischen 1 und 6 Prozent der amerikanischen Bevölkerung selbst als asexuell bezeichnen, und zwar mit stetig steigenden Zahlen während der letzten fünf Jahre (Bogaert, 2006; CNN, 2004).« (i.O.: »Most existing research on asexuality, for example, asks questions that have relatively little social and political significance. For example, some studies address prevalence rates, with most research reporting that between 1 and 6 per cent of the American population describe themselves as asexual, with numbers rising consistently during the past five years (Bogaert, 2006; CNN, 2004).« Fahs, 2010, 456.)
Obwohl Fahs in Sinwells Bibliografie nicht erwähnt wird, liefert uns Sennkestras Vermutung durchaus einen Anhaltspunkt dafür, woher Sinwells Aussage kommen könnte, dass »zwischen 1 und 6 Prozent der amerikanischen Bevölkerung» (i.O.: »between 1 and 6 percent of the American population« Sinwell, 2014, S. 328f., Hervorhebung wurde hinzugefügt) sich als asexuell bezeichnen würden.
Sennkestra stellt
außerdem ein paar Überlegungen dazu an, wie ein solcher Fehler es
in eine seriöse wissenschaftliche und peer-reviewte, d.h. durch
Fachleute geprüfte Publikation wie die »Asexualities«-Anthologie
schaffen konnte: »Teil des
Problems ist wahrscheinlich, dass das Feld asexueller Forschung klein
und relativ neu ist – jede Menge minderwertige Forschung, die in
anderen Feldern ignoriert würde, wird publiziert und bekommt eine
Menge Aufmerksamkeit, einfach weil es noch nichts besseres da draußen
gibt.« (i.O.: »Part of the problem is likely the small size and relative novelty
of the field of asexual research – a lot of poor quality research
that would be ignored in other fields gets published and gets a lot
of attention simply because there isn't anything better out there
yet.« Sennkestra, o.S.)
Einen weiteren möglichen Grund sieht Sennkestra darin, dass der Peer-Review-Prozess, den wissenschaftliche Publikationen durchlaufen müssen, im Kontext eines sehr kleinen Fachbereichs wie den Asexuality Studies notwendigerweise von Leuten übernommen werden muss, die keine oder allenfalls wenig Berührung mit Asexualität haben, »wodurch Dinge, die für Personen, die sich in dem Bereich auskennen, offensichtlich und eklatant falsch sind, für eine*n unvertraute*n Gutachter*in ohne die entsprechenden Kapazitäten für eine richtige Faktenüberprüfung angemessen erscheinen können.« (i.O.: »most of these articles are probably getting peer reviewed by people who know nothing about asexuality or asexual research, so things that are obviously and blatantly incorrect to someone familiar with the field may seem reasonable to an unfamiliar reviewer who doesn't have the time/effort to spare to actually factcheck things.« Sekknestra, o.S.) Wir lesen hieraus vor allem Kritik am akademischen System, das keinen oder nicht genug Raum (d.h. Zeit, Gelder und andere Kapazitäten) lässt, solche Aussagen ordentlich zu überprüfen. Dadurch können sich relativ leicht vermeidbare Fehler einschleichen, die wiederum innerhalb des wissenschaftlichen Systems immer mehr reproduziert werden und es so schließlich als ›Fakten‹ in die Öffentlichkeit schaffen.
Einen dritten möglichen Grund sieht Sennkestra darin, dass Forschung zu Asexualität von Personen betrieben wird, die keine oder kaum Berührung mit dem wissenschaftlichen Umgang mit Statistik haben – auch wenn uns hierzu keine Zahlen vorliegen, so sehen wir doch in dieser Aussage unsere eigenen Erfahrungen repräsentiert. Das wiederum, so Sennkestra, macht statistische Erhebungen und statistisch belegte Behauptungen in dem Bereich umso fehleranfälliger: »[I]m Falle von einigen queertheoretischen Ansätzen zu Asexualität werden diese häufig von Personen geschrieben oder geprüft, die nicht viel Ahnung von Statistik haben, wodurch, wie ich vermute, diese Art von Fehlern noch mehr überhandnehmen.« (i.O.: »in the case of some queer theory approaches to asexuality, they are often being written or reviewed by people who don't have much knowledge of statistics either, which I suspect may make these kinds of errors even more prevalent. «Sennkestra, o.S.) Auch hier bräuchte es mehr Kapazitäten im wissenschaftlichen System – entweder die Kapazität, sich adäquat weiterzubilden oder, wo das nicht möglich ist, entsprechendes Fachpersonal in den Forschungs- und Veröffentlichungsprozess stärker einzubinden.
Die Lektion, die Sennkestra aus dem Ganzen zieht, möchten auch wir uns zu Herzen nehmen: »Deswegen ist es wichtig, immer nochmals die Originalquellen zu verwenden, anstatt sich auf indirekte Referenzen zu verlassen!« (i.O.: »This is why it's important to always double check the original sources instead of relying on indirect references!« Sennkestra, o.S.) Dieser Aufruf gilt insbesondere für wissenschaftliche Publikationen, aber zum Beispiel auch für aktivistische. Zeitgleich möchten wir anerkennen, dass der Zugang zu Originalquellen oft erschwert ist – sei es beispielsweise aus sprachlichen, finanziellen oder räumlichen Gründen. Auch das Kennen(lernen) wissenschaftlicher Methoden und Grundsätze sowie der Zugang zu Universitäten und Wissenschaft hängt mit vielen Privilegien zusammen, die auch wir genießen und die notwendigerweise in unsere Arbeit einfließen. Hier schließt sich für uns ganz viel strukturelle Kritik an, z.B. in Bezug auf den gezielten Ausschluss bestimmter Gruppen aus Wissenschaft und aus akademischem Arbeiten.
Vor allem in den
Asexuality Studies besteht zudem zeitgleich die Möglichkeit und
Notwendigkeit eines engen Austauschs zwischen Wissenschaft,
Aktivismus und Alltag, d.h. zwischen akademischen und
nicht-akademischen Personen, zwischen Aktivismusbetreibenden und
Nicht-Aktivismusbetreibenden etc., die diesen Austausch mitunter sehr
komplex für alle Beteiligten machen. Asexuality Scholar C. D. Chasin
warnt etwa davor, dass (allo) Forschende mit unsensiblen Definitionen
von Asexualität schnell Ausschlüsse produzieren können:
»[U]nabhängig davon, welche Definition sie schlussendlich
verwenden, wenn Forschende Asexualität oder ace-Sein anders
definieren als ace Communities es tun, so werden sie
Forschungsergebnisse über eine Gruppe produzieren, die vermutlich
zwar eine gewisse Schnittmenge zur ace Community hat, die aber sowohl
theoretisch als auch praktisch grundlegend anders ist. Mit anderen
Worten: Forschungsergebnisse von Forschung zu Asexualität riskiert,
dass sie nur eingeschränkt auf tatsächliche Mitglieder der
asexuellen Communities zutrifft.« (i.O.: »regardless of the definition they ultimately adopt, if
researchers define asexuality or aceness differently than ace
communities do, they will produce research findings about a
population that presumably overlaps with ace community members but
which is substantively different both theoretically and pratically.
In other words, research findings from asexuality scholarship risks
only applying in limited ways to actual ace community members.«
Chasin, 2019, S. 210.)
Gerade vor diesem Hintergrund kann (und muss, wie wir finden) nicht nur in der Wissenschaft der Wunsch und die Forderung nach faktischer Richtigkeit bestehen – vor allem, da nicht alle Menschen, die mit Informationen wie der hier beschriebenen umgehen, die Originaltexte lesen und dadurch Aussagen überprüfen (können).
5. Über welche Asexualität reden wir überhaupt?
Kommen wir an der Stelle noch einmal kurz zurück zu Asexualität und zu der Frage, die oftmals am Anfang von Texten zu diesem Thema steht: Was ist das eigentlich?
Sennkestra hebt hervor, dass Bogaerts Studie »nichts mit Selbstidentität zu tun hatte, anders als Sinwell behauptet.« (i.O.: »had nothing to do with self identity, unlike Sinwell's claim.« Sennkestra, o.S.) Konkret bedeutet dass, dass Bogaert für seine Studie die Ergebnisse der Natsal-1 heranzieht und eine bestimmte Antwortoption als Asexualität interpretiert. Er definiert Asexualität als »die Abwesenheit einer traditionellen sexuellen Orientierung, in welcher ein Individuum wenig oder keine sexuelle Anziehung zu Männern oder Frauen aufweist« (i.O.: »the absence of a traditional sexual orientation, in which an individual would exhibit little or no sexual attraction to males or females« Bogaert, 2004, S. 279) und untersucht »lebenslange Asexualität im Verständnis von ›keine sexuelle Anziehung zu allen Geschlechtern‹« (i.O.: »lifelong asexuality, defined as having no sexual attraction for either sex« Bogaert, 2004, S. 279). Sein Verständnis von Sexualität (und damit auch von Asexualität) basiert auf Anziehung zu bestimmten Personen(gruppen), nicht auf bestimmten (sexuellen) Handlungen. Er schreibt:
»Es
ist zu beachten, dass die
Definition von Asexualität sich hier auf eine Abwesenheit sexueller
Anziehung zu allen Geschlechtern bezieht und nicht notwendigerweise
auf eine Abwesenheit von sexuellen Handlungen oder auf eine
Selbstidentifikation als
asexuell. Sexuelles Verhalten und sexuelle Selbstidentifikation
stehen natürlich in Beziehung zu sexueller Anziehung, aber aus einer
Vielzahl von Gründen müssen
die Anziehung zu Männern
oder Frauen, offenkundiges sexuelles Verhalten und
sexuelle Selbstidentifikation einer Person einander
nicht entsprechen.« (i.O.: »Note that the definition of asexuality here concerns a lack of
sexual attraction to either sex and not necessarily a lack of sexual
behavior with either sex or self-identification as an asexual.
Sexual behavior and sexual self-identification are of course
correlated with sexual attraction, but, for a variety of reasons,
one's attraction to men or women and overt sexual behavior or sexual
self-identification may have a less-than-perfect correspondence.« Bogaert, 2004, S. 279)
Das bedeutet, dass Bogaert für seine Studie ein anderes, ein einschränkenderes Verständnis von Asexualität verwendet als wir es beispielsweise tun (in »(un)sichtbar gemacht« schreiben wir: »Asexuell zu sein bedeutet keine, wenig, zeitweise und/oder nur unter bestimmten Umständen sexuelle Anziehung zu empfinden. Genauso kann es etwa bedeuten, keinen Sex haben zu wollen oder Sexualität als Konzept nicht zu verstehen. Asexualität bezeichnet dementsprechend ein Spektrum, das viele verschiedene Erfahrungen umfasst.« Baumgart & Kroschel, 2023, S. 15). Auf Basis dieser Definition von Asexualität hat Bogaert wiederum die Natsal-1-Umfrage interpretiert:
»Für die
vorliegende Studie habe ich als asexuell all diejenigen gezählt, die
diese Frage zu sexueller Anziehung beantwortet haben mit: ›Ich habe
mich nie zu irgendjemandem sexuell angezogen gefühlt‹. Ich habe
alle anderen Teilnehmenden als ›sexuell‹ eingeordnet –
diejenigen, die angaben, Anziehung zu entweder Männern, Frauen oder
beiden empfunden zu haben (männlich n = 7,932, weiblich n =
10,494).« (i.O.: »For the present study, I counted as asexuals those who responded
to this sexual attraction question with ›I have never felt sexually
attracted to anyone at all.‹ I categorized as ›sexuals‹ the
remaining participants – those reporting that they had felt
attraction to either males, females, or both (male n = 7,932, female
n = 10,494).« Bogaert, 2004, S. 281) Mittels
dieser Interpretation kommt er dann zu dem häufig zitierten
Ergebnis: »Von den Teilnehmenden berichteten 195 oder 1,05%,
asexuell zu sein.« (i.O.: »Of the participants, 195 or
1.05% reported being asexual.« Bogaert, 2004, S. 282)
Das ist aus wissenschaftlicher Sicht erstmal total in Ordnung; er darf das so machen. Gerade für den (heutigen) ace Aktivismus bedeutet das aber, dass Bogaert hier Asexualität als eine Fremdzuschreibung verwendet. Das hat wiederum Auswirkungen auf unsere Rezeption seiner Studienergebnisse. Denn wir zumindest vermuten bei Aussagen wie »Schätzungen zufolge sind ca. 1% der Menschheit a_sexuell« (Queer Lexikon, o.S.), dass damit Personen gemeint sind, die das Label ›asexuell‹ für sich verwenden. In Bogaerts 1%-Ergebnis sind jedoch explizit nicht solche Personen gemeint, die das Label ›asexuell‹ für sich verwenden, und es zum Beispiel in einer Umfrage als solches angekreuzt oder angegeben haben, sondern solche Personen, die angegeben haben, Zeit ihres Lebens keine sexuelle Anziehung zu anderen Personen empfunden zu haben.
Damit hängt auch die Tatsache zusammen, dass die britische Umfrage von Johnson et al. in den Jahren 1990 und 1991 durchgeführt wurde. Das heißt, diese Ergebnisse sind 35 Jahre alt (Stand: 2025) – oder in anderen Worten: massiv veraltet. Auch Bogaerts Studie selbst ist nicht mehr die jüngste (zur Erinnerung: sie ist aus dem Jahr 2004 und damit 21 Jahre alt, Stand: 2025). Das ist insofern relevant, als dass sich Verständnisse von Asexualität seitdem mitunter sehr stark gewandelt haben und zunehmend expansivere Definitionen verwendet werden. Bogaerts Kategorisierung von asexuell als »all diejenigen […], die diese Frage zu sexueller Anziehung beantwortet haben mit: ›Ich habe mich nie zu irgendjemandem sexuell angezogen gefühlt‹« (i.O. »For the present study, I counted as asexuals those who responded to this sexual attraction question with ›I have never felt sexually attracted to anyone at all‹« Bogaert, 2004, S. 281) entspricht einfach nicht vielen (Selbst-)Verständnissen von Asexualität als diverse Orientierung, als vielseitige Erfahrung und als Spektrum, das viele unterschiedliche Erlebnisse und Microlabel beinhaltet. Damit werden, wie C. D. Chasin beschreibt, einerseits Personen ausgeschlossen, die in anderen Definitionen von Asexualität mitgedacht werden (zum Beispiel Personen, die nie Sex haben/hatten, was eine geläufige frühe Definition von Asexualität war) und andererseits Personen miteingeschlossen, die selbst das Label asexuell nicht für sich verwenden (würden).
Natürlich müssen wir davon ausgehen, dass Asexualität als Label, als Begriff und als Option zum Zeitpunkt der Umfrage weder bei den Durchführenden noch bei den Teilnehmenden bekannt war – zumindest nicht bekannt und anerkannt genug, um explizit abgefragt zu werden. Das bedeutet, Bogaert hätte anhand der Natsal-1 gar kein Selbstverständnis von Asexualität herausfinden können. Tatsächlich war es aber auch gar nicht Ziel der Umfrage, Label herauszufinden, sondern es ging um Handlungsmuster sowie um persönliche und politische Einstellungen rund um Sexualität und (intime) Beziehungen. Es gibt aktuellere Studien und Umfragen, die – ähnlich wie die CNN-Umfrage – Selbstbezeichnungen abfragen. Da ein Überblick darüber jedoch mit unfassbar viel Arbeit verbunden ist und dieser Essay wahrlich schon lang genug ist, heben wir uns das an der Stelle für ein anderes Mal auf.
6. Warum müssen wir uns überhaupt rechtfertigen?
Abschließend möchten wir lieber die Frage stellen: Ist es überhaupt wichtig, wie viele asexuelle Personen es gibt, ob weltweit oder in einem einzigen Land?
Wir verstehen den Anreiz, den ein wissenschaftlich belegter Fakt(TM), eine greifbare Zahl, eine leicht zu merkende Statistik über die Menge an asexuellen Personen ausstrahlt: Es ist ein unanfechtbarer Beweis dafür, dass es uns gibt, dass wir nicht allein sind und dass Informationen zu uns veröffentlicht und geteilt werden können. Es ist quasi eine unabsprechbare Existenzberechtigung – es kann ein kleiner Moment der Überlegenheit im Aufklärungsgespräch über Asexualität sein oder auch ein Stück Wissen, das uns bestärken und empowern kann, wenn ein Coming Out nicht so gut verlief. Es kann uns genauso Hoffnung und Halt geben wie es anderen Menschen beim Verstehen und Akzeptieren von Asexualität helfen kann. All das möchten wir gar nicht absprechen.
Mit diesem Essay möchten wir vielmehr aufzeigen und ein Bewusstsein dafür schaffen, dass dieser 'unanfechtbare Beweis' gar kein FaktTM ist, der allgemeingültig und so ohne Weiteres einfach wahr ist. Unsere 'unabsprechbare Existenzberechtigung' ist bestenfalls ein Beispiel dafür, wie Fakten geschaffen werden, indem sie immer und immer wieder wiederholt werden, ohne in Frage gestellt zu werden. Sie ist ein Beispiel dafür, wie wichtig es ist, auf Kontexte zu achten und wie sorgsam mit Behauptungen umgegangen werden muss. Sie ist ein Beispiel dafür, wie viel Macht wir Mengenangaben im Kampf um Gleichberechtigung und Antidiskriminierung zu geben bereit sind – als müssten benachteiligte Gruppen irgendeine Form von Mindestmenge erfüllen, um in ihren Anliegen ernst genommen zu werden.
Doch unabhängig davon, ob wir eine Zahl brauchen, ob wir sie uns wünschen, ob wir uns an ihr festklammern wollen oder nicht – diese nachweisliche Falschbehauptung, dass 1% der Welt asexuell sei, kann uns nicht länger genügen.
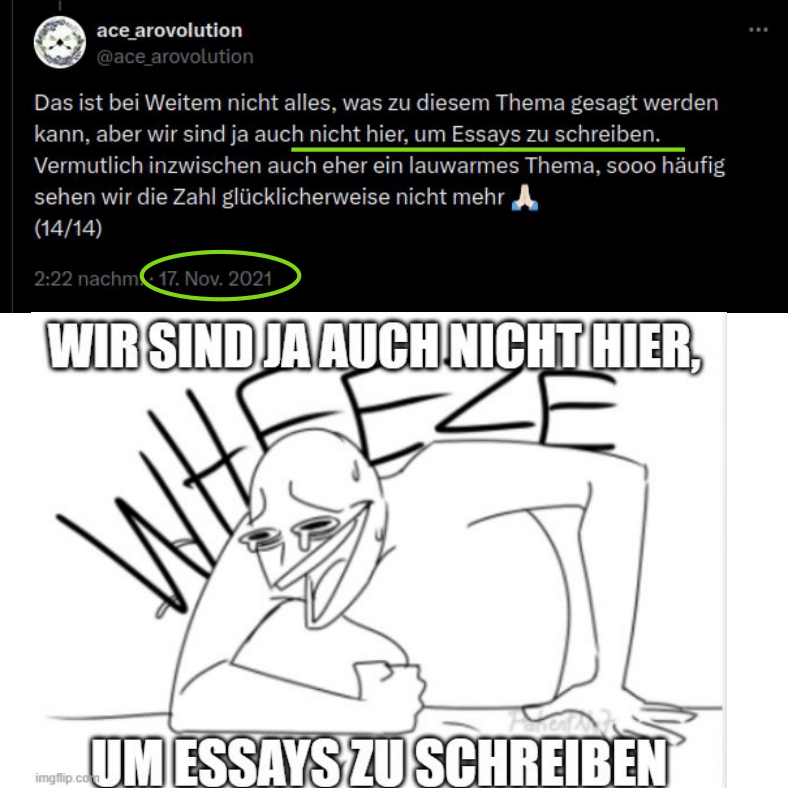
Bildbeschreibung: Screenshot von einem Tweet von ace_arovolution vom 17.11.2021: »Das ist bei Weitem nicht alles, was zu diesem Thema gesagt werden kann, aber wir sind ja auch nicht hier, um Essays zu schreiben. Vermutlich inzwischen auch eher ein lauwarmes Thema, sooo häufig sehen wir die Zahl glücklicherweise nicht mehr (14/14)«. Darunter ein Meme: Eine gezeichnete Figur haut lachend auf einen Tisch, Tränen kommen ihr aus den Augen, dahinter steht »Wheeze«. Drumherum der Text: »Wir sind ja auch nicht hier, um Essays zu schreiben«.
7. Literaturverweise
AktivistA (o.J.): »Asexualität: Nicht nur bei Amöben – Flyertext«, in: AktivistA. URL: https://aktivista.net/links/asexualitaet-nicht-nur-bei-amoeben-flyertext/ [3.12.2024].
Baumgart, Annika; Kroschel, Katharina (2023): (un)sichtbar gemacht. Perspektiven auf Aromantik und Asexualität. Münster: edition assemblage. 2. Aufl.
Bogaert, Anthony F. (2004): »Asexuality: Prevalence and Associated Factors in a National Probability Sample«, in: The Journal of Sex Research 41: 3. S. 279–287.
Bogaert, Anthony F. (2006): »Toward a Conceptual Understanding of Asexuality«, in: Review of General Psychology 10:3. S. 241–250.
Breanne Fahs (o.J.): »Breanne Fahs«, in: Breanne Fahs. URL: https://www.breannefahs.com/home.html [13.1.2025].
Brock University (o.J.): »Anthony F. Bogaert, PhD«, in: Brock University. URL: https://brocku.ca/applied-health-sciences/health-sciences/faculty-research/faculty-directory/anthony-f-bogaert-phd/#research-interests [3.12.2024].
- CNN (2004): »Study: One in 100 adults asexual«, in: WayBackMachine. URL: https://web.archive.org/web/20240918231505/https://www.cnn.com/2004/TECH/science/10/14/asexual.study/index.html [23.1.2025].
Fahs, Breanne (2010): »Radical refusals: On the anarchist politics of women choosing asexuality«, in: Sexualities 13:4. S. 445–461.
Natsal (o.J.): »Natsal-1«, in: Natsal. URL: https://www.natsal.ac.uk/projects/natsal-1/ [13.1.2025].
Natsal-about (o.J.): »About«, in: Natsal. URL: https://www.natsal.ac.uk/about/ [4.12.2024].
Overy, Caroline; Reynolds, Lois; Tansey, Elizabeth Matilda (2011): History of the National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles. The transcript of a Witness Seminar held by the Wellcome Trust Centre for the History of Medicine at UCL, London, on 14 December 2009, aus der Reihe »Wellcome Witnesses to Twentieth Century Medicine« Band 41. London: Queen Mary, University of London.
Queer Lexikon (o.J.): »A_sexualität«, in: Queer Lexikon. URL: https://queer-lexikon.net/uebersichtsseiten/a_sexualitaet/ [3.12.2024].
QuickVote (2004): »How would you categorize yourself?«, in: WayBackMachine. URL: https://web.archive.org/web/20240529063343/https://edition.cnn.com/POLLSERVER/results/13851.exclude.html [23.1.2025].
Sennkestra (2015): »The Anatomy of an Incorrect Citation«, in: Next Step Cake. URL: https://nextstepcake.wordpress.com/2015/04/30/the-anatomy-of-an-incorrect-citation/ [3.12.2024].
Sinwell, Sarah E. S. (2014): »Aliens and Asexuality. Media Representation, Queerness, and Asexual Visibility«, in: Cerankowski, K. J.; Milks, Megan (Hrsg.): Asexualities. Feminist and Queer Perspectives. New York: Routledge. S. 328–350.
